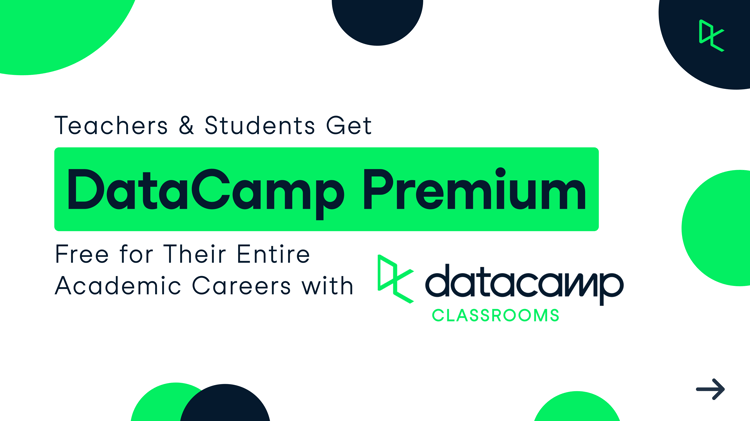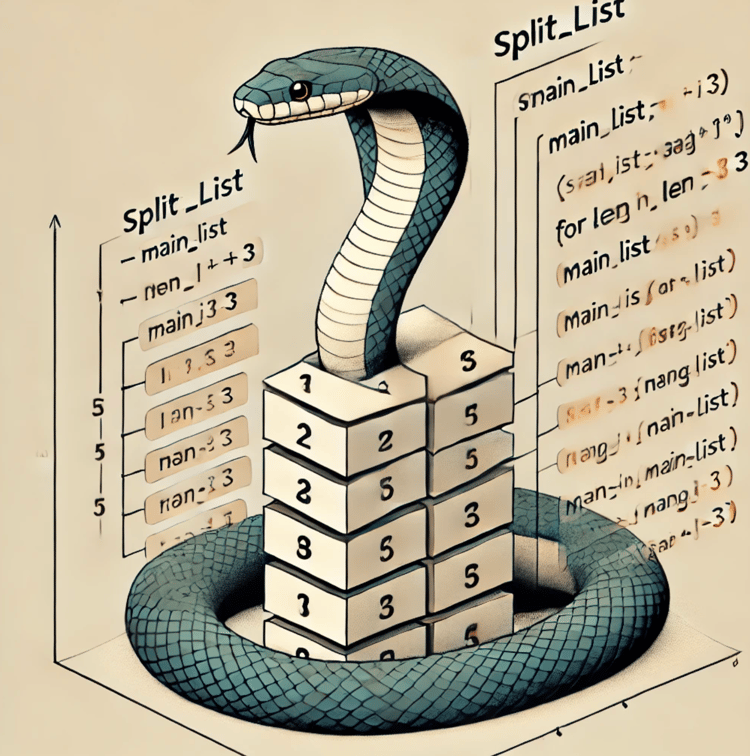Kurs
Große Sprachmodelle zu betreiben, kostet echt Geld. Du bezahlst für jeden verarbeiteten Token, jeden verwendeten GPU-Zyklus und jede zusätzliche Komplexitätsebene eines Modells. Auch wenn die Preise gesunken sind, wird die Rechnung schnell hoch, wenn du mit großen Anwendungen, langen Eingabeaufforderungen oder häufigen Updates arbeitest.
Ich hab schon gesehen, wie schnell das zum Problem wird. Die Teams denken, dass die Kosten im Griff bleiben, merken dann aber, dass sie ihr Budget für überdimensionierte Modelle, ineffiziente Eingabeaufforderungen oder ungenutzte Hardware verschwenden.
Deshalb hab ich 10 praktische Tipps, um die Kosten für Schlussfolgerungen zu senken. Von Quantisierung und Pruning bis hin zu Batching, Caching und Prompt Engineering – das sind die Methoden, die ich tatsächlich nutze, um LLMs bezahlbar zu halten, ohne dabei zu viele Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen.
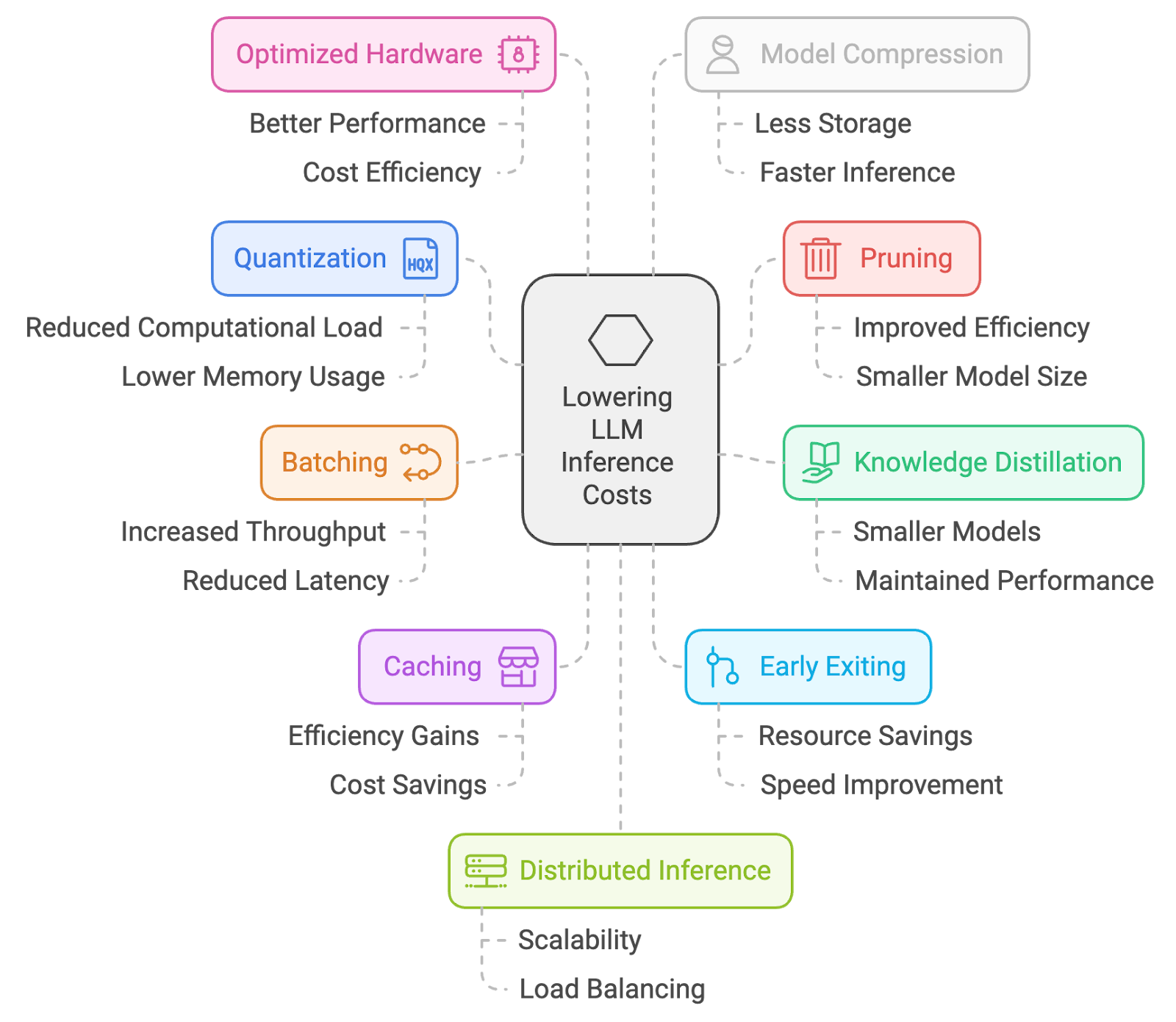
1. Quantisierung
Quantisierung ist ein Prozess, bei dem die Genauigkeit von Modellgewichten und Aktivierungen reduziert wird, normalerweise von 32-Bit-Gleitkommazahlen auf Darstellungen mit weniger Bits (z. B. 16 Bit oder sogar 8 Bit). Das spart Speicherplatz und Rechenleistung, sodass man auf Geräten mit wenig Ressourcen schneller Ergebnisse kriegt.
So geht's:
- Quantisierung nach dem Training (PTQ): Wandle die Gewichte des vortrainierten Modells in eine niedrigere Genauigkeit um (z. B. 8-Bit-Ganzzahlen), ohne es neu zu trainieren. Das ist ziemlich einfach, kann aber zu einem gewissen Genauigkeitsverlust führen.
- Quantisierungsbewusstes Training (QAT): Optimiere das Modell während des Trainings mit Quantisierungstechniken anpassen, was zu einer besseren Genauigkeitserhaltung führt.
Wie es hilft:
- Kleinere Modellgröße: Das heißt, die Ladezeiten werden kürzer und es wird weniger Speicher gebraucht, was die Kosten echt runterbringen kann, vor allem in Cloud-Umgebungen, wo man für die genutzten Ressourcen bezahlt.
- Schnellere Inferenz: Mit kleineren Zahlen geht das Rechnen schneller, was zu kürzeren Reaktionszeiten führt.
Der Hauptkompromiss ist, dass es vielleicht nicht mehr ganz so genau ist. Auch wenn moderne Quantisierungstechniken ziemlich gut sind, kann es immer zu einem leichten Rückgang der Modellgenauigkeit kommen.
2. Beschneiden
Das Beschneiden ist eine Technik, um unwichtige oder überflüssige Gewichte aus einem neuronalen Netzwerk zu entfernen. Durch das Entfernen von Verbindungen, die kaum Einfluss auf die Leistung des Modells haben, wird die Größe und die Rechenkomplexität des Modells reduziert, was zu einer schnelleren Inferenz führt.
So geht's:
- Unstrukturiertes Beschneiden: Entfernt einzelne Gewichte je nach ihrer Größe oder Wichtigkeit.
- Strukturiertes Beschneiden: Entfernt ganze Kanäle oder Filter, was zu regelmäßigeren Modellstrukturen führt, die auf Hardware effizient ausgeführt werden können.
Wie es hilft:
- Kleinere Modellgröße: Ähnlich wie bei der Quantisierung führt das Beschneiden zu einem kleineren Modell, das schneller geladen werden kann.
- Weniger Berechnungen: Weniger Verbindungen bedeuten weniger Berechnungen während der Inferenz, was zu schnelleren Reaktionszeiten führt.
Ähnlich wie bei der Quantisierung ist der Hauptkompromiss ein möglicher Genauigkeitsverlust. Ein zu starker Rückschnitt kann die Leistung echt beeinträchtigen. Es ist echt wichtig, die richtige Balance zu finden.
3. Wissensdestillation
Wissensdestillation ist ein Prozess, bei dem Wissen von einem großen, komplexen „Lehrer”-Modell auf ein kleineres, effizienteres „Schüler”-Modell übertragen wird. Das Studentenmodell lernt, das Verhalten des Lehrers nachzumachen, sodass es mit einer kleineren Größe und schnellerer Schlussfolgerung eine vergleichbare Leistung bringen kann.
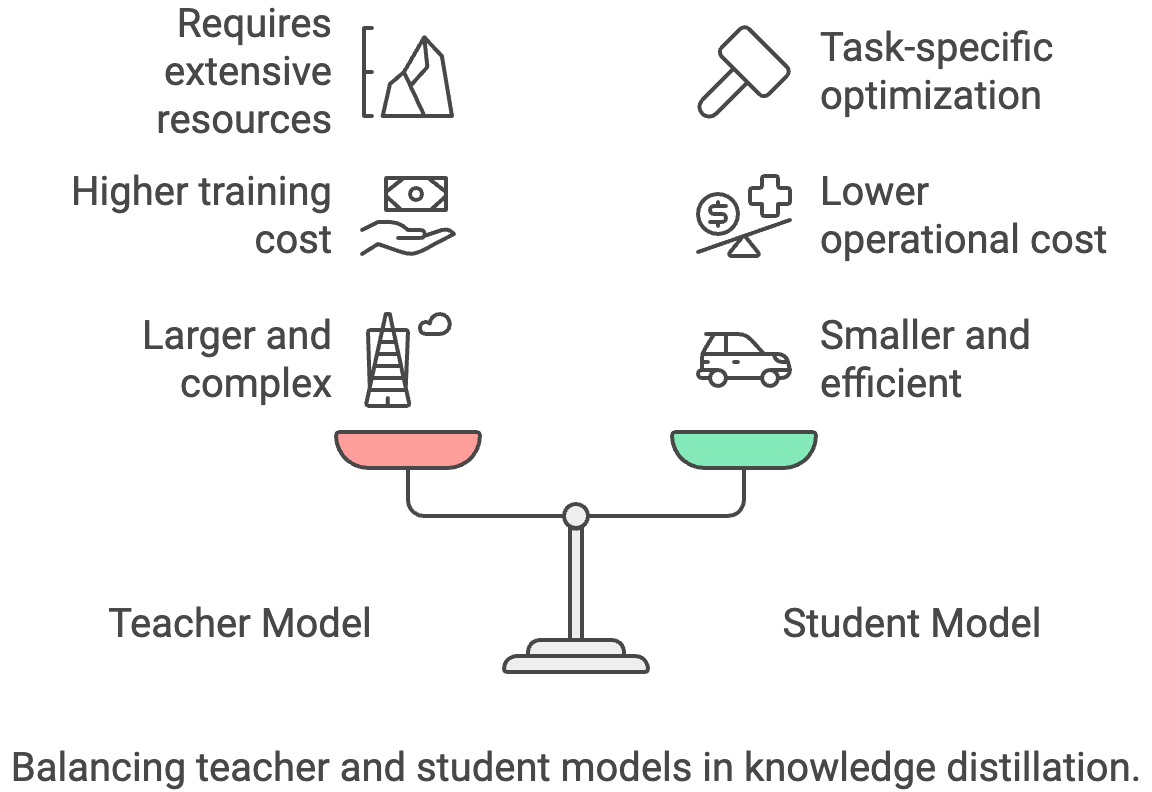
So geht's:
- Trainier ein kleineres Lernermodell: Nutze die größeren Ausgabewerte des Lehrer-Modells (Logits oder Soft-Labels) als zusätzliche Trainingssignale für das Schüler-Modell.
- Temperaturskalierung: Passe den Temperaturparameter während der Destillation an, um die Weichheit der Ausgabeverteilung des Lehrers zu steuern.
Wie es hilft:
- Viel kleineres Modell: Schülermodelle können deutlich kleiner und schneller sein als die ihrer Lehrer, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.
- Aufgabenspezifische Optimierung: Du kannst das Schülermodell für eine bestimmte Aufgabe optimieren, um es noch effizienter zu machen.
Der Hauptkompromiss ist, dass du Zugang zu einem leistungsstarken Lehrer-Modell brauchst, dessen Training oder Nutzung teuer sein kann.
4. Dosierung
Beim Batching werden mehrere Eingabeproben während der Inferenz gleichzeitig in einem Stapel verarbeitet. Das macht die Sache effizienter, weil die Hardware parallel arbeiten kann, was die Inferenz insgesamt schneller macht.
So geht's:
- Anfragen sammeln: Sammle mehrere Inferenzanfragen und bearbeite sie zusammen als einen Stapel.
- Dynamische Stapelverarbeitung: Passe die Stapelgröße dynamisch an die eingehenden Anforderungsraten an, um Latenz und Durchsatz auszugleichen.
Wie es hilft:
- Verbesserter Durchsatz: Durch Batching kann die Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Anfragen deutlich erhöht werden, was deine Anwendung effizienter macht.
- Bessere Hardware-Nutzung: GPUs sind für die parallele Verarbeitung gemacht, und mit Batching kannst du ihre Fähigkeiten voll ausnutzen.
Allerdings kann das Batching zusätzliche Verzögerungen bei einzelnen Anfragen verursachen, weil das System vielleicht wartet, bis genug Eingaben gesammelt sind, bevor es sie verarbeitet. Bei Echtzeit- oder Anwendungen mit geringer Latenz kann diese zusätzliche Verzögerung die Benutzererfahrung beeinträchtigen, wenn sie nicht sorgfältig abgestimmt wird. Dynamisches Batching hilft, das Problem zu lösen, macht das System aber komplizierter. Es besteht auch das Risiko einer ineffizienten Stapelverarbeitung bei ungleichmäßiger Auslastung, was die erwarteten Kosteneinsparungen verringern kann.
5. Zwischenspeicherung
Caching ist eine Technik, bei der die Ergebnisse früherer Berechnungen gespeichert und wiederverwendet werden, wenn man bei der Inferenz wieder auf die gleichen Eingaben stößt. Dadurch werden unnötige Berechnungen vermieden und der Inferenzprozess beschleunigt.
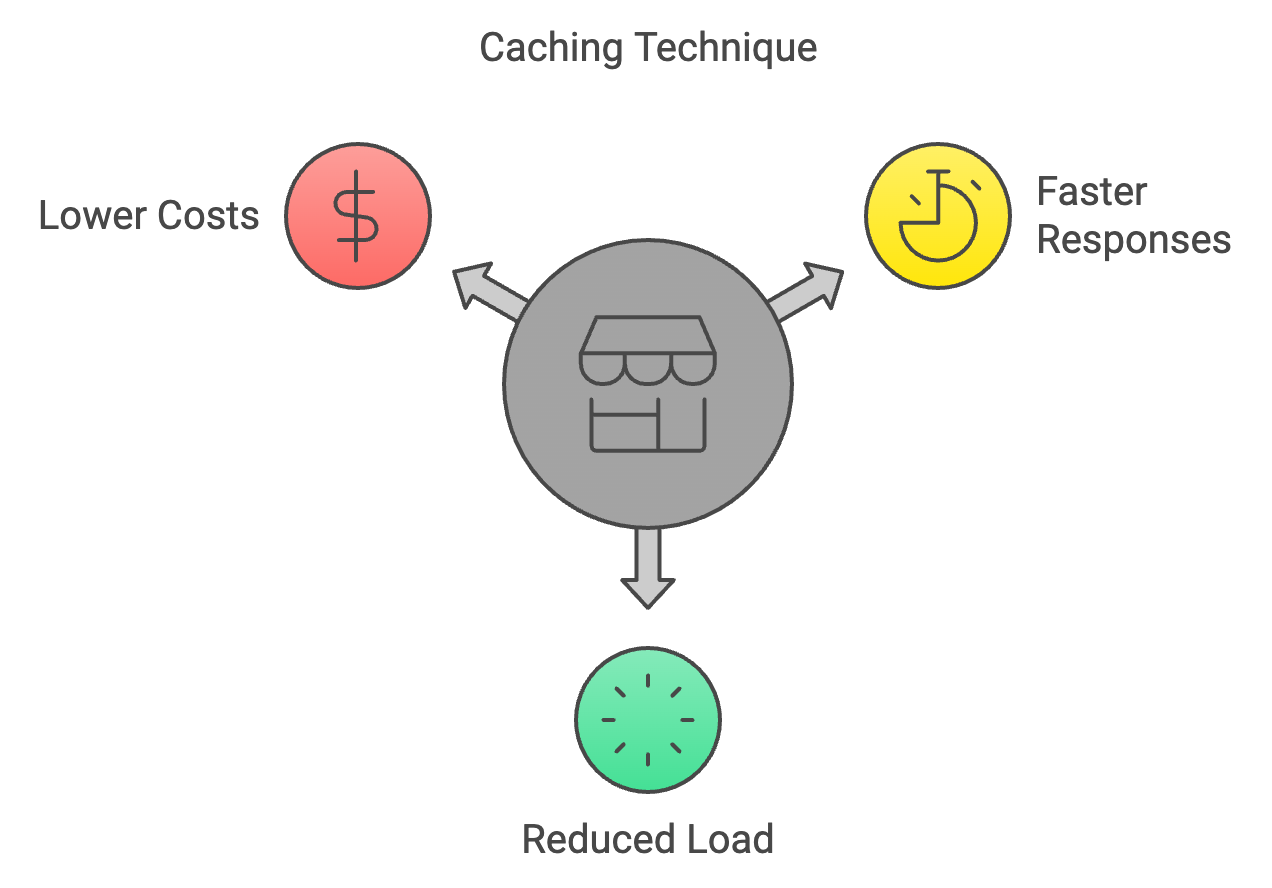
So geht's:
- Frühere Berechnungen speichern: Speichere einen Cache mit früheren Eingaben und den dazugehörigen Ausgaben.
- Cache-Eviction-Richtlinien: Mach es so, dass selten benutzte Sachen aus dem Cache rausgeschmissen werden, wenn er voll ist.
Wie es hilft:
- Schnellere Antworten bei wiederholten Anfragen: Caching ist echt super für Anwendungen, bei denen oft die gleichen oder ähnliche Anfragen kommen.
- Weniger Rechenaufwand: Weniger Berechnungen bedeuten weniger Kosten.
Caching ist aber nur dann sinnvoll, wenn sich Eingaben wiederholen oder überschneiden. Bei stark schwankenden Arbeitslasten können die Trefferquoten niedrig sein, und der Aufwand für die Pflege eines Caches kann die Vorteile überwiegen. Veraltete oder nicht mehr aktuelle Ergebnisse können auch zu Konsistenzproblemen führen, wenn die zwischengespeicherten Ausgaben nicht mehr die relevantesten Daten zeigen. Außerdem macht das Einrichten und Optimieren von Strategien zum Löschen von Cache-Daten die Technik komplizierter, vor allem in verteilten Systemen, wo die Synchronisierung des Caches echt schwierig ist.
6. Frühes Verlassen
Frühes Beenden heißt, dass die Berechnung während der Inferenz vorzeitig gestoppt wird, wenn das Modell von seiner Vorhersage ziemlich überzeugt ist. Das spart Rechenleistung und macht die Schlussfolgerung bei einfacheren Fällen schneller, wo man nicht den ganzen Vorwärtsdurchlauf braucht.
So geht's:
- Vertrauensschwelle: Leg eine Schwelle fest, wie sicher das Modell bei seiner Vorhersage sein soll. Wenn das Vertrauen den Schwellenwert in einer Zwischenschicht überschreitet, hör mit der Berechnung auf und gib die aktuelle Ausgabe zurück.
- Anpassungsfähiges frühes Beenden: Passe den Schwellenwert dynamisch an, je nachdem, was du eingibst oder welche Modellschicht du nutzt, um Geschwindigkeit und Genauigkeit unter einen Hut zu bringen.
Wie es hilft:
- Schnellere Schlussfolgerung bei einfachen Fällen: Wenn das Modell die Ausgabe schon früh zuverlässig vorhersagen kann, spart das Zeit und Rechenaufwand.
- Geringere Kosten: Weniger Berechnungen bedeuten weniger Kosten.
Der Nachteil ist, dass ein frühes Beenden in manchen Fällen zu einer etwas geringeren Genauigkeit führen kann, vor allem bei komplizierten Eingaben.
7. Optimierte Hardware
Bei dieser Technik werden spezielle Hardware-Architekturen und Beschleuniger genutzt, die für effiziente KI-Berechnungen entwickelt wurden. Dazu gehören GPUs, TPUs und andere spezielle KI-Chips, die im Vergleich zu Allzweck-CPUs bei Inferenzaufgaben deutlich besser abschneiden.
So geht's:
- Grafikkarten: Nutze die Parallelverarbeitungsfähigkeiten von GPUs für Matrixoperationen und Berechnungen in neuronalen Netzen.
- TPUs: Nutze spezielle Tensor-Prozessoren, die extra für KI-Aufgaben entwickelt wurden.
- Andere KI-Beschleuniger: Schau dir mal neue Hardware-Optionen wie FPGAs oder spezielle KI-Chips an.
Wie es hilft:
- Viel schnellere Schlussfolgerung: GPUs und spezielle Chips sind für die Berechnungen, die LLMs brauchen, viel schneller als CPUs.
- Bessere Energieeffizienz: Das heißt, dass die Energiekosten auf lange Sicht niedriger sind.
Spezialisierte Hardware braucht aber oft viel Geld im Voraus und kann dich an ein bestimmtes Anbieter-System binden. GPUs, TPUs oder benutzerdefinierte Beschleuniger können auch schwieriger konsistent in der Cloud bereitgestellt werden, vor allem bei Spitzenauslastung. Lokale Installationen bringen Probleme bei Wartung und Skalierung mit sich, während Cloud-Optionen höhere laufende Mietkosten verursachen können. Schließlich kann die Anpassung von Software zur vollständigen Nutzung spezieller Hardware die technische Komplexität erhöhen und eine kontinuierliche Optimierung erfordern.
8. Modellkompression
Modellkomprimierung heißt, mehrere Techniken zu nutzen, um die Größe und Komplexität eines Modells zu reduzieren, ohne dass die Leistung stark darunter leidet. Das kann zum Beispiel das Beschneiden, Quantisieren, die Wissensdestillation oder andere Methoden sein, die ein kompakteres und effizienteres Modell für schnellere Schlussfolgerungen schaffen sollen.
So geht's:
- Kombiniere mehrere Techniken: Kombiniere Quantisierung, Pruning, Wissensdestillation und andere Methoden, um die optimale Verkleinerung des Modells zu erreichen.
- Tensorzerlegung: Große Gewichtsmatrizen in kleinere, effizientere Darstellungen zerlegen.
Wie es hilft:
- Kleinere Modellgröße: Das heißt, es lädt schneller, braucht weniger Speicherplatz und kann die Kosten senken.
Modellkompression kann die Genauigkeit beeinträchtigen, wenn die Techniken zu aggressiv oder ohne sorgfältige Abstimmung angewendet werden. Wenn man Methoden wie Pruning, Quantisierung und Destillation kombiniert, wird das System komplizierter und man muss es vielleicht nochmal trainieren oder anpassen. Komprimierte Modelle können auch weniger flexibel für die Übertragung auf neue Aufgaben sein, weil Optimierungen oft den Bereich der Szenarien einschränken, in denen das Modell gut funktioniert. Manchmal kann die Zeit, die man für die Komprimierung braucht, und der Rechenaufwand die kurzfristigen Einsparungen wieder aufheben.
9. Verteilte Inferenz
Verteilte Inferenz ist ein Ansatz, um die Inferenz-Arbeitslast auf mehrere Maschinen oder Geräte zu verteilen. Dadurch können große Inferenzaufgaben parallel bearbeitet werden, was die Latenzzeit verkürzt und den Durchsatz verbessert.
So geht's:
- Modellaufteilung: Verteil das Modell auf mehrere Maschinen, wobei jede einen Teil der Berechnung übernimmt.
- Lastverteilung: Verteil die eingehenden Anfragen auf die verfügbaren Maschinen, um eine effiziente Ressourcennutzung sicherzustellen.
Wie es hilft:
- Kann größere Modelle und mehr Traffic abwickeln: Mit verteilter Inferenz kannst du große Aufgaben auf mehrere Maschinen verteilen und so größere Modelle und mehr Anfragen gleichzeitig bearbeiten. Dadurch wird die Hardware effizienter und man kann in der Cloud flexibel skalieren, was alles zu Kosteneinsparungen führt.
Verteilte Inferenz macht das System ziemlich kompliziert, weil die Koordination der Berechnungen über mehrere Maschinen hinweg eine robuste Orchestrierung, Synchronisation und Fehlertoleranz braucht. Netzwerklatenz und Bandbreitenbeschränkungen können die Leistungssteigerungen zunichte machen, vor allem wenn viele Zwischendaten ausgetauscht werden müssen. Außerdem steigen die Infrastrukturkosten, weil man zusätzliche Hardware und Mechanismen für den Lastausgleich bereitstellen und warten muss. Das Debuggen und Überwachen von verteilten Systemen kann schwieriger sein, was die Zuverlässigkeit im Vergleich zu Einzelsystemen zu einer Herausforderung macht.
10. Prompt-Engineering
Prompt Engineering ist ein Prozess, bei dem Eingabeaufforderungen sorgfältig erstellt werden, um große Sprachmodelle (LLMs) dazu zu bringen, die gewünschten Ergebnisse zu generieren. Durch klare, prägnante und spezifische Eingabeaufforderungen können Nutzer die Qualität und Steuerbarkeit von LLM-Antworten verbessern, sodass diese für bestimmte Aufgaben relevanter und nützlicher werden.
So geht's:
- Sei klar und prägnant: Benutze in deinen Anweisungen eine klare und eindeutige Sprache.
- Kontext bereitstellen: Füge relevante Hintergrundinfos oder Beispiele hinzu, um dem LLM eine Orientierung zu geben.
- Probier's aus und mach's immer wieder: Probier verschiedene Formulierungen aus und schau dir die Ergebnisse an, um die besten zu finden.
Wie es hilft:
- Besser und knackiger: Gutes Prompt Engineering kann die Anzahl der vom Modell zu generierenden Token reduzieren, was zu einer schnelleren und möglicherweise kostengünstigeren Inferenz führt.
- Bessere Genauigkeit: Klare Anweisungen können dem Modell helfen, Missverständnisse zu vermeiden und genauere Antworten zu geben.
Prompt Engineering braucht ständige Experimente und Iterationen, was echt zeitaufwendig sein kann und je nach Anwendungsfall unterschiedlich ist. Gut gemachte Eingabeaufforderungen lassen sich vielleicht nicht verallgemeinern, sodass du sie neu gestalten musst, wenn sich Aufgaben oder Modelle ändern. Verbesserungen beim Prompt-Design können auch anfällig sein – kleine Änderungen im Wortlaut oder Modellaktualisierungen können die Ergebnisse auf unvorhersehbare Weise verändern. Zu viel auf Prompt Engineering zu setzen, ohne ergänzende Techniken wie Kontextmanagement oder Feinabstimmung, kann die Skalierbarkeit und langfristige Kosteneinsparungen einschränken.
Bonus: Kontext-Engineering
Kontext-Engineering ist die Praxis, Systeme zu entwickeln, die steuern, welche Informationen ein LLM sieht, bevor es eine Antwort generiert. Anstatt alles in das Kontextfenster zu stopfen, wählst du nur die relevantesten Details aus und ordnest sie – wie zum Beispiel den Benutzerverlauf, abgerufene Dokumente oder Tool-Ausgaben –, damit das Modell effizienter arbeiten kann.
So geht's:
- Zusammenfassung des Kontexts: Pack die gesammelten Gesprächsverläufe oder Dokumente in kürzere Zusammenfassungen, um die Bedeutung zu behalten und gleichzeitig die Anzahl der Zeichen zu reduzieren.
- Verwaltung der Werkzeugausstattung: Benutz Suchsysteme, um nur die relevantesten Tools oder Beschreibungen auszuwählen, anstatt alle verfügbaren Optionen durchzugehen.
- Kontextbeschneidung: Entferne veraltete oder überflüssige Infos, wenn neue Daten reinkommen, damit der aktive Kontext übersichtlich und nützlich bleibt.
- Kontextüberprüfung und Quarantäne: Erkenne und isoliere Halluzinationen oder Fehler, bevor sie das Langzeitgedächtnis beeinträchtigen.
Wie es hilft:
- Weniger Token verbrauchen: Kürzere und fokussiertere Texte bedeuten weniger zu verarbeitende Zeichen, was direkt die Kosten senkt.
- Bessere Genauigkeit: Ein klarerer Kontext heißt, dass das Modell weniger wahrscheinlich durch unwichtige oder widersprüchliche Details abgelenkt oder verwirrt wird.
- Schnellere Schlussfolgerung: Mit weniger Tokens und einem stabileren KV-Cache werden Anfragen schneller erledigt, was Rechenressourcen spart.
Der Nachteil ist, dass man für den Aufbau guter Kontextsysteme erst mal viel Entwicklungsarbeit investieren muss. Du brauchst Pipelines für das Abrufen, Zusammenfassen und Validieren, und ein schlechtes Design kann zu Kontextlücken führen, die die Leistung beeinträchtigen. Aber wenn man es richtig macht, macht Context Engineering große Anwendungen zuverlässiger und günstiger.
Fazit
Die Senkung der LLM-Inferenzkosten ist keine einfache Sache. Es geht darum, Ansätze zu kombinieren, die für deine Arbeitslast sinnvoll sind. Techniken wie Quantisierung, Pruning und Wissensdestillation machen Modelle kleiner. Batching, Caching und verteilte Inferenz machen die Bearbeitung von Anfragen besser. Die Wahl der Hardware und die Modellkomprimierung machen die Effizienz noch besser, während Prompt- und Context-Engineering unnötige Token-Nutzung an der Quelle reduzieren.
Die Kompromisse sind echt: Jede Methode bringt Komplexität, mögliche Genauigkeitsverluste oder Infrastruktur-Overhead mit sich. Aber die Gewinne summieren sich. Schon wenn du ein paar dieser Techniken anwendest, kannst du Modelle bezahlbar halten, die Nutzung ohne ausufernde Kosten skalieren und Systeme aufbauen, die auch bei wachsenden Modellen und Anwendungen nachhaltig bleiben.
Senior GenAI Engineer und Content Creator, der mit seinem Wissen über GenAI und Data Science bereits 20 Millionen Views erreicht hat.